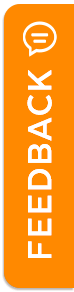Dieses Kapitel studieren wir aktuell im Rahmen unserer Predigtserie durch das Matthäusevangelium beim Feierabend-Gottesdienst, jeden Donnerstag um 19 Uhr im Gemeindehaus. Letzte Woche haben wir die Verse 1-16 betrachtet, am Donnerstag geht es mit Vers 17 weiter. An dieser Stelle möchte ich einfach mal ganz herzlich dazu einladen, mit dabei zu sein.
In den ersten 16 Versen spricht Jesus in Form eines Gleichnisses über den Zugang zum Himmelreich und den Lohn der Nachfolge. Im Gleichnis geht jeder Arbeiter freiwillig mit, weil er mit dem vereinbarten Lohn bzw der allgemeinen Aussicht auf Entlohnung einverstanden ist. Doch als sie dann bezahlt werden, neiden die ersten Arbeiter es denen, die für nur eine Stunde Arbeit den gleichen Lohn bekommen. Sie erwarten jetzt für sich mehr als den vereinbarten Lohn.
Das mag nach unserem Gerechtigkeitsempfinden gut nachvollziehbar sein … aber andererseits ist es halt so, dass der Arbeitgeber natürlich das Recht hat, großzügig zu sein.
- Der Punkt dieses Gleichnisses ist nun natürlich nicht, dass wir uns das Himmelreich verdienen müssen, sondern, dass der HERR das Recht hat, jedem gnädig zu sein, dem er gnädig sein will. Jeder, der zu ihm kommt und sich in seinen Dienst stellt, wird das Reich ererben. Dabei geht es dann aber eben nicht darum, wie lange wir als Christen auf Erden gelebt haben, oder wie viel wir gearbeitet haben. Es geht allein darum, dass wir zum Herrn kommen.
Dieses „Nicht-Leistungs-Prinzip“ kommt dann auch in den Worten Jesus auf die Frage der Mutter der Zebedäus-Söhne zum Ausdruck: „Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt!“ … auch wenn diese Aussage nicht in allen Schriftzeugnissen an dieser Stelle steht (sie kommt dann aber auf jeden Fall in 22,14).
Die Aussage „die Letzten werden die ersten sein“ deutet an, dass Gott eben nicht nach weltlichen Maßstäben richtet.
- Uns sollte das nicht dazu motivieren, weniger zu machen, denn unsere primäre Motivation in allem sollte ohnehin nicht der Lohn sein, sondern unsere Liebe zum HERRN! Und vor allen sollten wir niemals anderen die Gnade Gottes neiden, auf die wir selber angewiesen sind.
So werden wir dann in allen Dingen froh voran gehen, auch wenn der Weg mal schwer wird … und damit sollten wir rechnen, denn Jesus kündigt ja in den Versen 17ff nicht nur sein eigenes Leiden an, sondern ergänzt dann in V.23, dass die Jünger auch schwere Zeiten erleben werden.
Die Heilung der Blinden am Ende des Kapitels zeigt Jesu Barmherzigkeit und ist ein großartiges Bild dafür, wie wir alle davon abhängig sind, dass Jesus uns die Augen (für geistliche Wahrheiten) auftut. Außerdem macht es uns Mut, unsere Bitten vor Jesus zu bringen, denn wenngleich er manchmal Bitten nicht direkt annimmt (wie bei der Mutter und Frau des Zebedäus), so tut er es eben doch immer wieder.